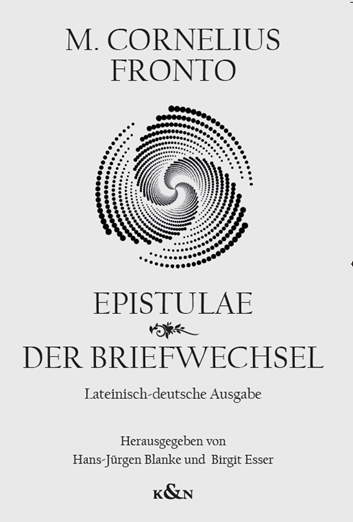Marcus Cornelius Fronto – ein wiederzuentdeckender Autor und sein Briefwerk in deutscher Übersetzung
Nach ihrem Ende ist die Antike immer wieder zu einem Thema von Historikern, Philosophen, Literaten, Künstlern usw. geworden. Zu groß ist die Anziehungskraft dieser Epoche, als dass man sie für belanglos erklären könnte.
Da die Faszination der Antike ungebrochen bis in die Gegenwart fortdauert, erstaunt es dennoch, dass es immer wieder Facetten bzw. Aspekte gibt, die dem Blick des Betrachters zwar nicht ganz entgangen sind, aber doch in ihrem Stellenwert nicht recht erkannt wurden. Dies geschieht nach der Erkenntnis von Hegel, dass das, was bekannt ist, noch lange nicht erkannt sei (vgl. G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes, Ullstein, Frankfurt am Main u. a. 1970, S. 28).

Kaiser Mark Aurel als Triumphator im Viergespann [Urheber: Matthias Kabel; https://upload.wikimedia.org /wikipedia/commons/b/b5/Bas_relief_from_Arch_of_Marcus_Aurelius_triumph_chariot.jpg; Stand 5.Sept. 2025]
Beinahe alle lateinischen Autoren sind ins Deutsche übersetzt worden. So verwundert es doch, dass ein Autor und zugleich eine namhafte Persönlichkeit der römischen Geschichte des 2. Jahrhunderts nach Chr. diese Wertschätzung einer Übersetzung ins Deutsche bislang nicht erfahren hat. Gemeint ist der Rhetoriklehrer, Grammatiker und Anwalt Marcus Cornelius Fronto (ca. 95 bis 170 n. Chr.), der über mehrere Jahrzehnte eine intensive Beziehung zum Kaiserhaus der Antoninen pflegte, aber bis auf Zitate und Bruchstücke in Literaturgeschichten und wissenschaftlichen Ausgaben mit seinem Werk im Deutschen nicht präsent ist. Ein Grund dafür könnte in der nicht unproblematischen Überlieferung des Werkes liegen, das Fronto hinterlassen hat. Die Überlieferung von Frontos Werk ist in mehrfacher Hinsicht problematisch – so problematisch, dass man lange Zeit davon ausging, Frontos Schriften seien vollständig verloren. Der heutige Bestand beruht auf einer geradezu spektakulären, zugleich aber lückenhaften und beschädigten Textüberlieferung. Erst im 19. Jahrhundert entdeckte Angelo Mai im Vatikanpalimpsest (Vat. lat. 5750) die über die Acta Conciliorum hinweg abgeschabten Texte. Hinzu kommt, dass die Lesbarkeit des Vatikan-Palimpsests aufgrund von Beschädigungen, seines fragmentarischen Charakters und mancher Entstellungen äußerst schwierig ist. Es gibt Unsicherheiten in der Echtheitsbestimmung. Aber auch wenn die Überlieferung nur einen winzigen Ausschnitt aus einem vormals umfangreichen Werk darstellt, lohnt sich eine Beschäftigung mit dem Leben und Werk Frontos.
Marcus Cornelius Fronto war einer der bedeutendsten Redner und Schriftsteller des 2. Jahrhunderts nach Christus und ein zentraler Vertreter der sogenannten „Zweiten Sophistik“. Fronto stand als angesehenster Rhetoriklehrer seiner Zeit in enger Verbindung zu den römischen Kaisern Antoninus Pius, Mark Aurel und Lucius Verus, denen er als Lehrer und Berater diente. Die erhaltenen Werke von Fronto bestehen überwiegend aus Briefen, die einen einzigartigen Einblick in das politische und kulturelle Leben des Römischen Reiches bieten. Diese Briefe zeugen von seiner tiefen Verbundenheit zu seinen Schülern, insbesondere Mark Aurel, und enthalten wertvolle Reflexionen über die lateinische Sprache, die Rhetorik sowie das Leben im Kaiserhaus.
Das Zeitalter der Antonine (ca. 96–192 n. Chr.) gilt als einer der Höhepunkte in der Geschichte des Römischen Reiches: Es war geprägt von innerer Stabilität, wirtschaftlichem Wohlstand und einer Philosophie der vernünftigen Herrschaft durch die sogenannten „Adoptivkaiser“. Denn die antoninische Herrschaft wurde nicht unwesentlich von Humanität und Philosophie geprägt. Zugrunde liegt eine Staatsvorstellung, die Mark Aurel in seinen „Selbstbetrachtungen“ als Ideal verherrlicht, wenn er „die Vorstellung von einem Staate, der nach gleichen Gesetzen und nach dem Grundsatze der Bürger und Rechtsgleichheit verwaltet, und von einem Reiche, wo die Freiheit der Beherrschten höher denn alles geachtet wird“, hervorhebt (vgl. Marc Aurel: Wege zu sich selbst. Übersetzt von Carl Cleß, Frankfurt a.M. 2010, Nr. 14). Insofern ist Edward Gibbons Urteil nachvollziehbar, dass diese Epoche, von Trajan bis Marcus Aurelius, „die glücklichste und prosperierendste Zeit der Menschheit“ gewesen sei (vgl. dazu: E. Gibbon, The decline and fall oft he Roman empire, London o.J., S. 73).
Mark Aurel verkörpert bis heute das Ideal des stoischen Herrschers. Seine „Selbstbetrachtungen“ sind ein Schlüsseltext der antiken Philosophie. Nicht ohne Grund hat das Rheinische Landesmuseum Trier im Jahr 2025 in einer archäologischen Ausstellung an Hand von Exponaten einen chronologischen Gang durch das facettenreiche Leben und die Epoche des römischen Kaisers präsentiert. Noch intensiver aber als über zufällig zusammengestellte Exponate erfährt man etwas über Mark Aurel und sein Zeitalter durch Frontos Briefe, da an der Gültigkeit der Aussage, dass Worte flüchtig sind, nur das Geschriebene
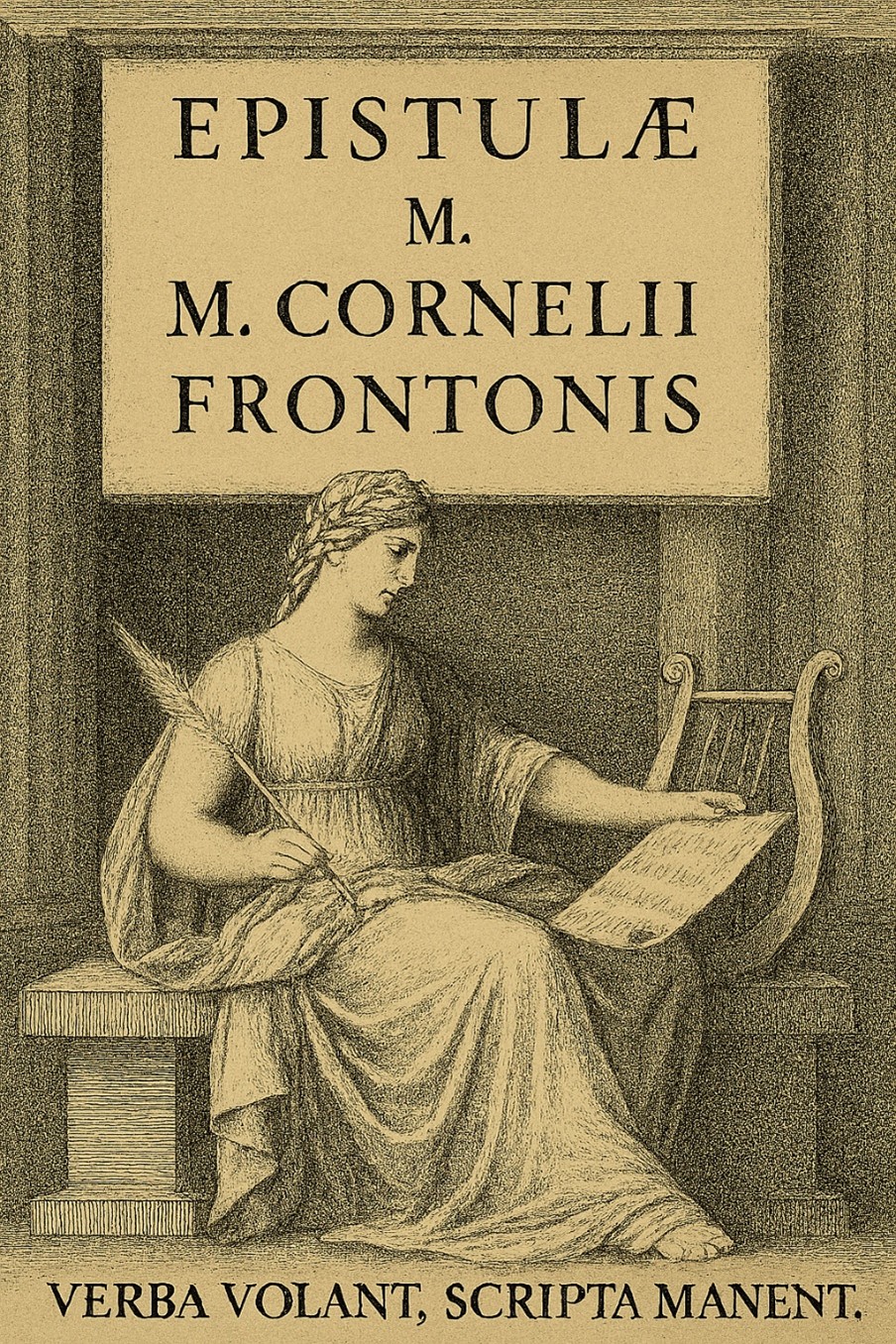
Allegorische Darstellung der Rhetorik (KI-generiert)
bleibe (s. die allegorische Darstellung der Rhetorik), nicht zu zweifeln ist. Denn neben Reden (von denen nur Titel und Fragmente erhalten sind) verfasste Fronto zahlreiche Briefe an Freunde, Schüler und Mitglieder des Kaiserhauses. Der Großteil der kaiserlichen Briefe ist an Marcus Aurelius gerichtet – Frontos berühmtesten Schüler, den er von etwa 139 n. Chr. pädagogisch begleitet. In diesen Schreiben verbinden sich pädagogischer Ernst, rhetorische Eleganz und persönliche Nähe. Fronto tritt als Lehrer, Mentor und moralischer Wegweiser auf, der über Stil- und Sprachfragen hinaus Lebensführung und Herrschertugend vermittelt. Nicht nur, dass Fronto seinen Schüler in alten Texten nach seltenen Wörtern suchen und ihn zum Gebrauch in dessen eigenen Schriften Listen solcher Wörter erstellen lässt, er gibt ihm auch Themen für die Deklamation vor, die in der republikanischen Vergangenheit angesiedelt sind und von Marcus manchmal vorsichtig in Frage gestellt werden. So kritisiert Mark Aurel etwa das Thema von dem Konsul, der dafür getadelt wird, dass er als Gladiator gekämpft und einen Löwen getötet habe, als „unwahrscheinlich“. Marcus antwortet Fronto mit auffallender Zärtlichkeit, schwärmerischer Dankbarkeit und ehrlicher Sorge um das Wohlergehen seines Lehrers – auch nach seiner Thronbesteigung. Diese Beziehung war von gegenseitiger Hochachtung geprägt, aber nicht spannungsfrei. So entwickelt Marcus im Laufe der Jahre ein wachsendes Interesse an der stoischen Philosophie, während Fronto am klassischen Ideal der Rhetorik festhält.
Ein zentraler Themenkreis ist das Leben am Hof der Antoninen bzw. deren Herrscherethik. Als kaiserlicher Lehrer, Senator und ehemaliger Konsul gewährt Fronto intime Einblicke in das höfische Milieu – ein Geflecht aus Loyalität, Zurückhaltung, strategischer Kommunikation und subtiler Machtausübung. Zwischen Nähe und Distanz lavierend, beschreibt er die Balance zwischen Unterordnung und Integrität, zwischen höfischem Takt und persönlicher Wahrhaftigkeit. Besonders im Umgang mit Marcus Aurelius betont Fronto immer wieder die Bedeutung moralischer Selbstkontrolle und sozialer Ausgleichsfähigkeit als Kern kaiserlicher Herrschaft. Entsprechend bestärkt Fronto Marcus in seiner Herrschertugend und betont die Versöhnung von Gegensätzen, den Ausgleich von Interessengegensätzen und die Notwendigkeit sozialer Harmonie. Die Briefe reflektieren eine Ethik der Mäßigung und des Ausgleichs, in der Tugend und Bildung als Garanten politischer Stabilität erscheinen. Sie illustrieren eindrucksvoll, wie kulturelle Selbstvergewisserung auch unter widrigen Bedingungen möglich ist – durch Sprache, Stilbewusstsein und intellektuelle Verbundenheit.
Frontos Briefe bieten eine lebendige Sprachwelt – jenseits der Klassik. Im Unterschied zur stilisierten Prosa der augusteischen und flavischen Autoren ist Frontos Stil oft ungeschliffen, dialogisch, affektgeladen – manchmal ungenau, immer jedoch lebendig. Gerade diese Nähe zur gesprochenen Sprache, mit Wiederholungen, Umwegen und Spontaneitäten, verleiht dem Briefkorpus eine Authentizität, die klassische Werke selten bieten. Fronto gebraucht Sprache nicht nur als Mittel der Mitteilung, sondern als Form des Daseins: Ausdruck von Selbstvergewisserung, sozialer Zugehörigkeit und geistiger Lebensführung. So wird vielleicht auch leichter nachvollziehbar, dass das Lateinische nicht nur eine durch Syntax und Komplexität sich auszeichnende Schriftsprache im Stil Ciceros war, sondern auch als eine lebendige, gesprochene Sprache eines bedeutenden Volkes wahrgenommen werden kann.
Der Anfang des Briefwechsels zwischen Fronto und seinem Schüler Mark Aurel möge das Gesagte im lateinischen Original und deutscher Übersetzung exemplarisch verdeutlichen:
1.1 Caesari suo Fronto
[...] Mittam igitur tibi quantum pote librum hunc descriptum.
Vale, Caesar, et ride et omnem vitam laetare et parentibus optimis et eximio ingenio tuo fruere.
1.2 M. Caesar M. Frontoni magistro meo
1 Quid ego ista mea fortuna satis dixerim vel quomodo istam necessitatem meam duris-simam condigne incusavero, quae me istic ita animo anxio tantaque sollicitudine prae-pedito alligatum attinet neque me sinit ad meum Frontonem ad meam pulcherrimam animam confestim percurrere, praesertim in huiusmodi eius valetudine propius videre, manus tenere, ipsum denique illum pedem, quantum sine incommodo fieri possit, ad-trectare sensim, in balneo fovere, ingredienti manum subicere? Et tu me amicum vocas, qui non abruptis omnibus cursu concitato pervolo? Ego vero magis sum claudus cum ista mea verecundia, immo pigritia. O me, quid dicam? Metuo, quicquam dicere, quod tu audire nolis; nam tu quidem me omni modo conisus es iocularibus istis tuis ac lepidissimis verbis a cura amovere atque te omnia ista aequo animo perpeti posse ostendere. At ego ubi animus meus sit nescio; nisi hoc scio, illo nescio, quo ad te profectum eum esse. Cura, miserere, omni temperantia, abstinentia omnem istam tibi pro tua virtute tolerandam, mihi vero asperrimam nequissimamque valetudinem depellere et ad aquas proficisci. Si et quando et nunc ut commode agas, cito, oro, perscribe mihi et mentem meam in pectus meum repone. Ego interim vel tales tuas litteras mecum gestabo.
2 Vale, mihi Fronto iucundissimme, quamquam ita me dispositius dicere oportet (nam tu quidem postulas talia): O qui ubique estis di boni, valeat, oro, meus Fronto iucundis-simus atque carissimus mihi, valeat semper integro, inlibato, incolumi corpore, valeat et mecum esse possit. Homo suavissime, vale.
1.1 Fronto an Marcus Caesar
Fronto grüßt seinen Caesar.
[…] Ich werde dir das beschriebene Buch schicken, soweit es möglich ist.
Lebe wohl, Caesar, lache und freue dich des Lebens, genieße den Umgang mit deinen vortrefflichen Eltern und nutze deine außerordentliche Begabung!
1.2 Marcus Caesar an Fronto
Marcus Caesar grüßt seinen Lehrer Fronto.
1 Was soll ich sagen, das angemessen ist für mein Unglück, oder wie soll ich mich an-gemessen über diese meine sehr harte Zwangslage beschweren, die mich hier festhält, während ich mit so bangem und von so großer Sorge gehemmten Herzen gefesselt bin, und die nicht zulässt, dass ich sofort zu meinem Fronto, zu meiner schönsten Seele, eile, und ihn insbesondere bei einer Krankheit dieser Art von Nahem sehe, die Hände halte, schließlich jenen Fuß selbst kaum merklich berühre, soweit es ohne Ungemach geschehen kann, ihn im Bad pflege und beim Gehen die Hand reiche? Und du nennst mich Freund, obwohl ich mich nicht sofort von allem losgerissen habe und in raschem Lauf herbeieile? Ich aber hinke noch mehr aufgrund dieser meiner Zurückhaltung, keineswegs aufgrund meiner Trägheit. Weh mir, was soll ich sagen? Ich fürchte, etwas zu sagen, was du nicht hören willst; denn du hast dir in der Tat Mühe gegeben, mich auf jede Weise mit deinen Scherzen und sehr witzigen Worten von Sorge zu befreien und zu zeigen, dass du dieses alles mit Gelassenheit ertragen kannst. Aber ich weiß nicht, wo mein Gleichmut geblieben ist; wenn ich nicht einmal dieses weiß, weiß ich auch nicht, inwieweit er zu dir aufgebrochen ist. Sorge dafür, hab Erbarmen, mit jeglicher Mäßigung und Enthaltsamkeit diese Krankheit ganz zu vertreiben, die für dich entsprechend deiner Standhaftigkeit erträglich, für mich aber sehr niederschmetternd und äußerst untauglich ist, und sorge dafür, dass du zu den Heilquellen gelangst! Bitte, schreibe mir schnell, ob und wann du aufbrichst und wie du jetzt zweckmäßig handelst, und gib mir innere Ruhe zurück! Ich werde unterdessen wenigstens solche Briefe von dir mit mir führen.
2 Lebe wohl, mein sehr liebenswürdiger Fronto, obwohl ich ordnungsgemäß so reden müsste (denn du allerdings forderst solches): Oh, ihr guten Götter, die ihr überall seid, ich bitte euch, mein äußerst liebenswürdiger und hochgeschätzter Fronto möge sich wohl befinden, möge immer unversehrt, ungeschwächt und unverletzt sein, es möge ihm gut gehen und er soll immer bei mir sein können. Du liebenswertester Mann, leb wohl!
Dr. Hans-Jürgen Blanke
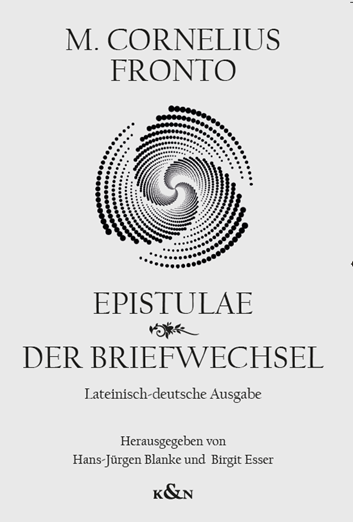

Kontakt

Lassen Sie sich von unserer Leidenschaft anstecken und von unseren vielfältigen Erfahrungen inspirieren.